XXIII. Deutsch-Polnisches Verwaltungskolloquium in Greifswald
XXIII. Deutsch-Polnisches Verwaltungskolloquium in Greifswald

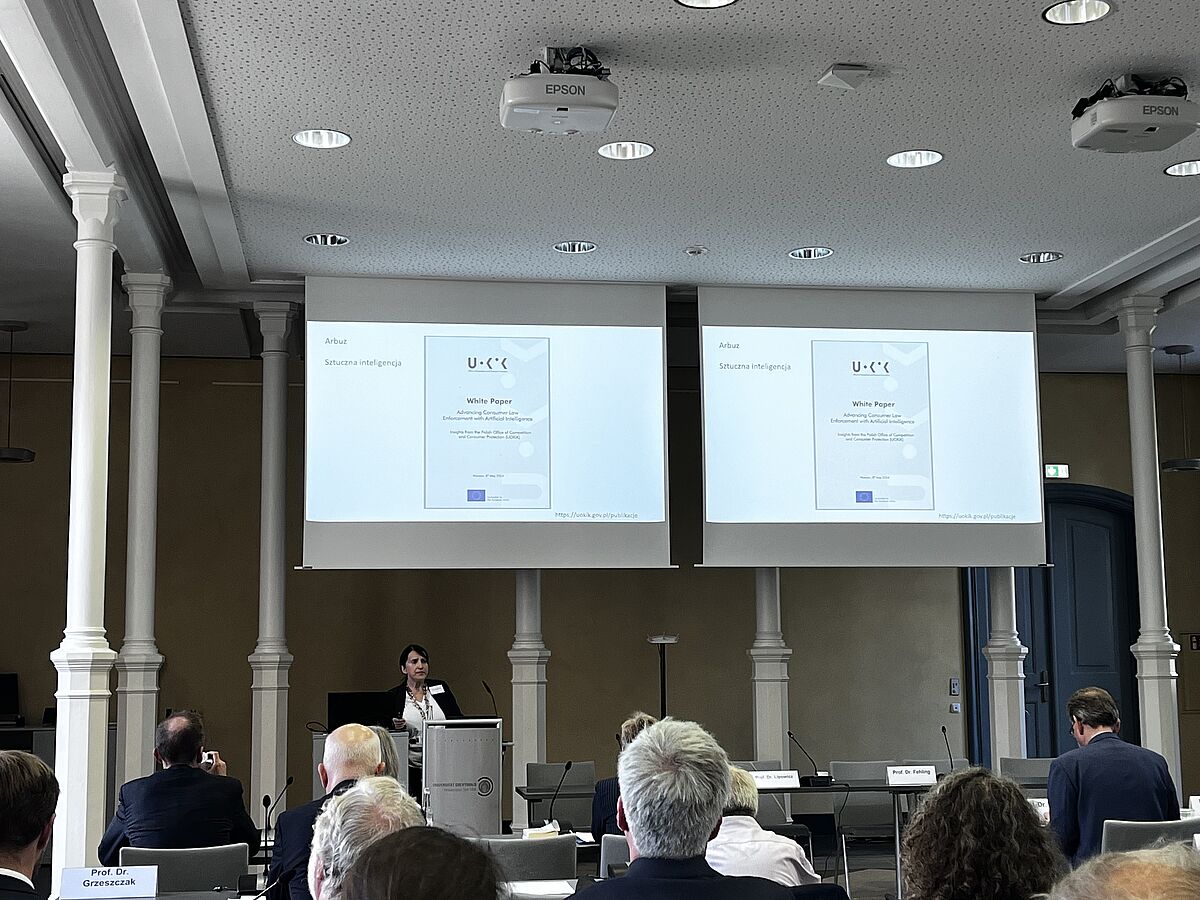


Im Zeitraum vom 8. bis zum 10. September 2024 fand das XXIII. Deutsch-Polnische Verwaltungskolloquium zum Thema „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI)
in Verwaltungsrecht und -praxis“ in Greifswald statt. Die Durchführung der traditionsträchtigen Veranstaltung oblag dieses Mal Prof. Dr. Sabine Schlacke (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insb. Verwaltungs- und Umweltrecht, Universität Greifswald). Prof. Dr. Matthias Ruffert (Walter-Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin) und Prof. Dr. Irena Lipowicz (Kardynał-Stefan-Wyszyński-Universität-Warschau) und Prof. Dr. Wojciech Piątek (Adam-Mickiewicz-Universität Posen) begleiteten die Organisation.
Das Deutsch-Polnische Verwaltungskolloquium wird bereits seit den 1970er Jahren im Zwei-Jahres-Rhythmus alternierend in Deutschland und Polen, jeweils drei Tage lang im September, ausgetragen. Diese über 50 Jahre alte Tradition, die auch die schwierigen Zeiten des „Kalten Krieges“ und „Eisernen Vorhanges“ überdauert hat, verleiht der Veranstaltung den Status eines Unikats unter den binationalen Diskussionsforen. Von einem Refugium für sicheren und freien, hochkarätigen fachlichen Austausch im Öffentlichen Recht, mit dem Ziel, den wissenschaftlichen Dialog über alle Systemgrenzen hinweg und trotz der damit verbundenen Widrigkeiten nicht abreißen zu lassen, hat es sich zu einem prominenten Forum für grenzüberschreitenden Austausch mit festem Teilnehmer*innen-Kreis entwickelt.
Unter dem Titel „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) in Verwaltungsrecht und -praxis“ thematisierten insgesamt knapp 40 Wissenschaftler*innen aus Deutschland und Polen gemeinsam Herausforderungen und Lösungsoptionen, die sich im Zusammenhang mit der rasanten Entwicklung und dem zunehmenden Einsatz „lernender“ IT-Systeme im öffentlichen Recht stellen; beginnend mit dem Versuch einer (rechtlichen) Definition von KI über die Analyse der ersten gesetzgeberischen Bestrebungen, KI legislativ einzuhegen, hin zu Überlegungen betreffend bestehender und potentieller Einsatzfeldern von KI in Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft. Wiederkehrender Topos aus polnischer und deutscher Perspektive war das Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit nach einem stärkeren Einsatz von Recht als KI- und Digitalisierung steuerndem, werteschützendem Instrument einerseits und großen Ungewissheiten in tatsächlicher Hinsicht andererseits: So bedarf bspw. die EU-KI-Verordnung einer KI-Definition zwecks Festlegung des Anwendungsbereichs, der Begriff der KI wird in der Informatik allerdings uneinheitlich verwandt und beschreibt teilweise rechtlich nur sehr schwer einhegbare Prozesse.
Die Antworten aus Deutschland und Polen auf die identifizierten Fragen fielen zwar z. T. unterschiedlich aus. Die ihnen zugrundeliegenden Problemstellungen hingegen waren sowohl in tatsächlicher als auch rechtlicher Hinsicht, da regelmäßig unionsrechtlich überwölbt, weitgehend gleich. Dieser Befund macht auf eindrucksvolle Weise deutlich, wie sehr sich die Lebenswirklichkeiten und infolgedessen rechtliche Herausforderungen in beiden Ländern angeglichen haben – eine, kontrastiert mit der Situation, die während der Anfänge des Kolloquiums gegeben war, überaus bemerkenswerte Entwicklung, die insgesamt Mut macht, weiterhin gemeinsam Lösungen zu suchen und zu finden.
